Redispatch 2.0: Was bedeutet das für Ihre Energiekosten?
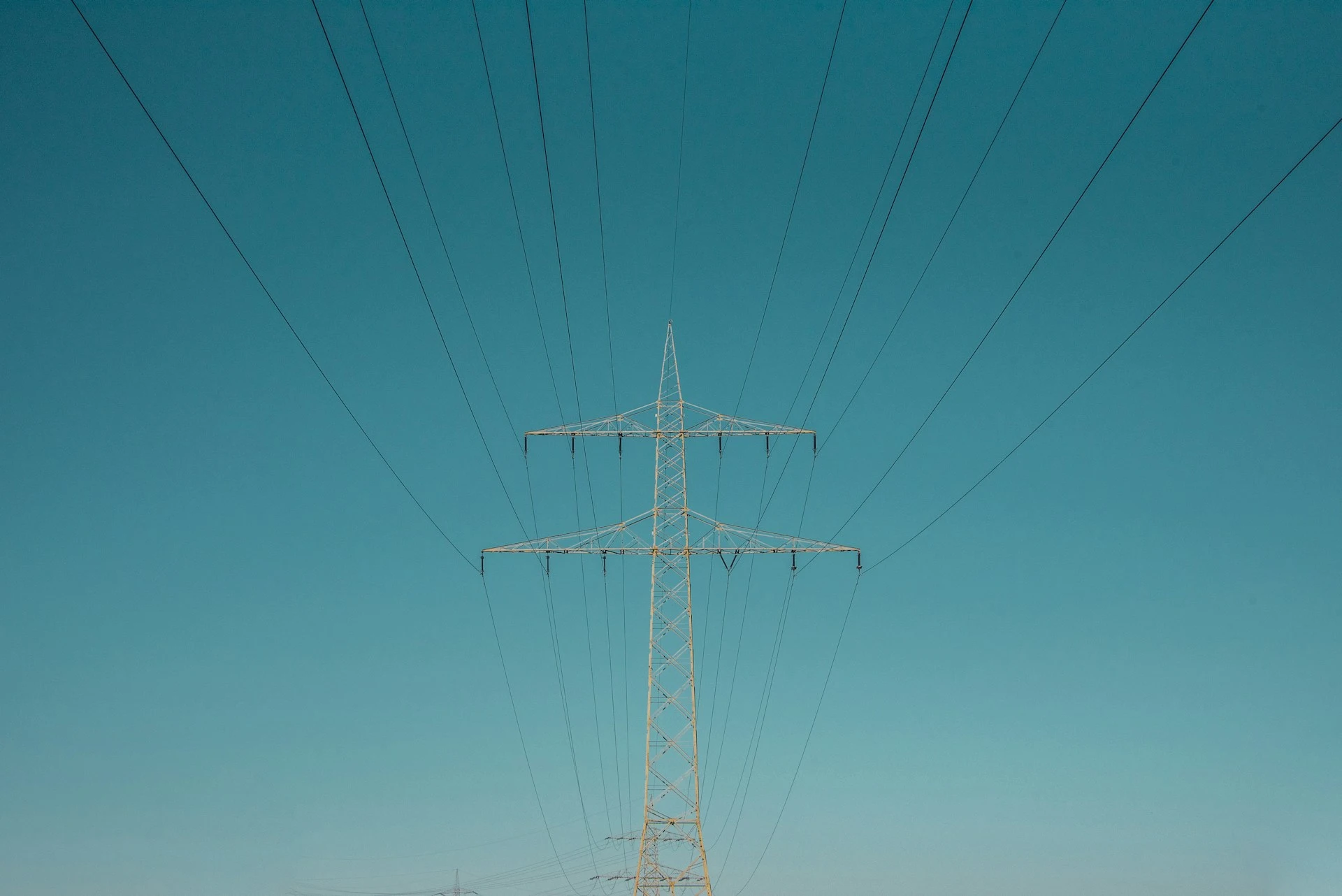
Die Energiewende stellt das deutsche Stromnetz vor große Herausforderungen. Mit dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien und dem Atomausstieg verändern sich die Lastflüsse im Netz grundlegend. Um Netzengpässe zu vermeiden und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurde das Redispatch 2.0 eingeführt. Doch was bedeutet das konkret für Unternehmen und wie können sie sich optimal darauf einstellen?
Redispatch 2.0 in Kürze
Redispatch 2.0 regelt, wie Netzbetreiber Stromerzeugung flexibel steuern, um Engpässe im Stromnetz zu vermeiden. Seit 2021 betrifft das auch viele kleinere Anlagen und erneuerbare Energien. Unternehmen müssen ihre technischen Abläufe und IT-Systeme anpassen, um Fahrpläne und Meldungen korrekt zu übermitteln. Wer frühzeitig vorbereitet ist und moderne Energiemanagement-Software nutzt, kann nicht nur gesetzliche Vorgaben leichter erfüllen, sondern auch Kosten sparen und zur Netzstabilität beitragen.
Was ist Redispatch 2.0 und warum wurde es eingeführt?
Die Stabilität unseres Stromnetzes ist eine komplexe Aufgabe, die durch die Energiewende noch anspruchsvoller wird. Redispatch 2.0 stellt eine Weiterentwicklung des bisherigen Netzengpassmanagements dar.
Definition Redispatch
Unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Droht an einer bestimmten Stelle im Netz ein Engpass, werden Kraftwerke angewiesen, ihre Einspeisung zu drosseln oder zu erhöhen. Auf diese Weise wird ein Lastfluss erzeugt, der dem Engpass entgegenwirkt.
Von Redispatch 1.0 zu Redispatch 2.0
Mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG 2.0) wurden die bisherigen Regelungen zum Redispatch grundlegend überarbeitet. Seit dem 1. Oktober 2021 sind nicht mehr nur konventionelle Kraftwerke ab 10 MW betroffen, sondern auch kleinere Anlagen ab 100 kW installierter Leistung. Dies schließt erneuerbare Energien und KWK-Anlagen ein. Zudem sind nun auch Verteilnetzbetreiber (VNB) verpflichtet, am Redispatch teilzunehmen.
Wie funktionieren Redispatch-Maßnahmen in der Praxis?
Das Prinzip des Redispatch basiert auf einem ausgeklügelten System von Anpassungen der Stromerzeugung, um Netzengpässe zu vermeiden oder zu beseitigen.
Ablauf einer Redispatch-Maßnahme
- Kraftwerksbetreiber melden täglich ihre Einsatzplanung (Fahrpläne) für den Folgetag an den Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)
- Die ÜNB führen Lastflussberechnungen durch und identifizieren potenzielle Engpässe
- Bei drohenden Engpässen werden Redispatch-Maßnahmen angeordnet
- Die betroffenen Anlagen passen ihre Erzeugung entsprechend an
- Die wirtschaftlichen Nachteile werden den Anlagenbetreibern vergütet
Welche Bilanzierungsmodelle gibt es im Redispatch 2.0?
Im Rahmen des Redispatch 2.0 wurden zwei unterschiedliche Bilanzierungsmodelle eingeführt, die je nach Anlagentyp und -größe zur Anwendung kommen.
Planwertmodell vs. Prognosemodell
Beim Planwertmodell übermittelt der Einsatzverantwortliche (EIV) täglich einen Prognosefahrplan an den Verteilnetzbetreiber. Dieser Fahrplan dient als Basis für die Berechnung der Ausfallarbeit bei einer Redispatch-Maßnahme. Das Planwertmodell wird vorwiegend für größere Anlagen und Anlagenverbünde genutzt.
Das Prognosemodell hingegen ist das Standardmodell zur Bilanzierung der Ausfallarbeit bei kleineren Anlagen. Hier wird die Ausfallarbeit auf Basis von standardisierten Einspeiseprofilen oder historischen Daten berechnet, ohne dass der Anlagenbetreiber täglich Fahrpläne übermitteln muss.
Wie hat sich der Redispatch 2.0 seit seiner Einführung entwickelt?
Seit der Einführung im Oktober 2021 hat der Redispatch 2.0 einige Entwicklungen durchlaufen, die für Unternehmen relevant sind.
Übergangslösungen und aktuelle Herausforderungen
Nach dem Start im Oktober 2021 gab es zunächst eine Übergangslösung bis Mai 2022, um den Beteiligten Zeit für die technische und organisatorische Umsetzung zu geben. Dennoch bestehen weiterhin Herausforderungen bei der technischen Implementierung und den Prozessen.
Aktuelle regulatorische Entwicklungen
Im September 2024 hat die Bundesnetzagentur ein Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung des Redispatch 2.0 veröffentlicht. Dieses sieht unter anderem eine schrittweise Überführung von Anlagen im Verteilnetz in das Planwertmodell vor. Ein entsprechendes Gesetzesverfahren ist für 2025/26 geplant.
Welche Positionen vertreten die verschiedenen Stakeholder?
Die Weiterentwicklung des Redispatch 2.0 wird von verschiedenen Interessengruppen unterschiedlich bewertet.
BDEW-Position zur Weiterentwicklung
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat im April 2025 eine Stellungnahme zur Fortentwicklung des Redispatch 2.0 veröffentlicht. Der Verband begrüßt grundsätzlich die Weiterentwicklung, fordert aber praxisnahe Lösungen und ausreichende Übergangsfristen für die Umsetzung neuer Anforderungen.
BEE-Kritik an den geplanten Änderungen
Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat in seiner Stellungnahme vom Juni 2025 kritisiert, dass die geplante Abschaffung der Wahlmöglichkeiten zwischen den Bilanzierungsmodellen für Anlagenbetreiber problematisch sei. Zudem fordert der BEE verbindliche Sanktionsmechanismen gegen Netzbetreiber, die Nichtbeanspruchbarkeitsmeldungen systematisch missachten.
Welche Praxistipps helfen Anlagenbetreibern und EIV?
Für Unternehmen, die vom Redispatch 2.0 betroffen sind, gibt es konkrete Handlungsempfehlungen, um sich optimal auf die aktuellen und kommenden Anforderungen einzustellen.
IT-Vorbereitung für effizientes Redispatch-Management
Investieren Sie in geeignete IT-Systeme, die eine effiziente Übermittlung von Fahrplänen und Nichtbeanspruchbarkeitsmeldungen ermöglichen. Die Digitalisierung der Prozesse hilft, den administrativen Aufwand zu reduzieren und Fehler zu vermeiden.
Entscheidung zwischen Plan- und Prognosemodell
Prüfen Sie sorgfältig, welches Bilanzierungsmodell für Ihre Anlagen am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur den aktuellen Stand, sondern auch die zu erwartenden regulatorischen Entwicklungen. ecoplanet bietet hier Unterstützung bei der Analyse und Entscheidungsfindung.
Nichtbeanspruchbarkeiten richtig melden
Achten Sie auf eine korrekte und rechtzeitige Meldung von Nichtbeanspruchbarkeiten. Dies ist besonders wichtig für Anlagen, die vorrangig zur Deckung von Eigenverbrauch genutzt werden. Die BEE-Stellungnahme empfiehlt hier ein zusätzliches Nichtbeanspruchbarkeitsdatum für die Selbstversorgung mit Wärme.
Wie sieht der Ausblick für Redispatch 2.0 bis 2030 aus?
Die Entwicklung des Redispatch 2.0 wird auch in den kommenden Jahren weitergehen, um den Herausforderungen der Energiewende gerecht zu werden.
Planwertmodell als zukünftiger Standard
Es zeichnet sich ab, dass das Planwertmodell langfristig zum Standard werden könnte. Die Bundesnetzagentur plant eine schrittweise Überführung von Anlagen im Verteilnetz in dieses Modell, was für Anlagenbetreiber eine Umstellung der Prozesse bedeuten würde.
Rechtliche Anpassungen in Vorbereitung
Für 2025/26 ist ein Gesetzesverfahren zur Weiterentwicklung des Redispatch 2.0 geplant. Unternehmen sollten die regulatorischen Entwicklungen aufmerksam verfolgen und sich frühzeitig auf Änderungen einstellen.
Integration in ein ganzheitliches Energiemanagement
Softwarelösungen wie ecoplanet helfen Unternehmen dabei, Redispatch-Anforderungen in ein ganzheitliches Energiemanagement zu integrieren. Dies ermöglicht nicht nur die Erfüllung regulatorischer Pflichten, sondern auch die Optimierung der eigenen Energiekosten.
Fazit: Redispatch 2.0 als Herausforderung und Chance
Der Redispatch 2.0 stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen, bietet aber auch Chancen für ein effizienteres Energiemanagement. Die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz erfordert neue Ansätze zum Engpassmanagement, bei denen alle Akteure – von großen Kraftwerksbetreibern bis hin zu kleineren Anlagenbetreibern – ihren Beitrag leisten müssen.
Mit der richtigen Vorbereitung und geeigneten Tools wie der Energiemanagementsoftware von ecoplanet können Unternehmen nicht nur ihre regulatorischen Pflichten erfüllen, sondern auch von optimierten Prozessen und Kosteneinsparungen profitieren. Der Schlüssel liegt in einem proaktiven Ansatz: Informieren Sie sich frühzeitig über kommende Änderungen, passen Sie Ihre Systeme und Prozesse entsprechend an und nutzen Sie die Expertise von Fachleuten, um die komplexen Anforderungen des Redispatch 2.0 zu meistern.
Die Weiterentwicklung des Redispatch-Regimes wird auch in den kommenden Jahren weitergehen. Unternehmen, die sich jetzt gut aufstellen, werden von dieser Entwicklung profitieren und einen wichtigen Beitrag zur Stabilität unseres Stromnetzes leisten.
Quellen
Redispatch 2.0: Neue Impulse zur Weiterentwicklung | BDEW
Redispatch 2.0: neue Regelungen | Bayernwerk Netz GmbH
Redispatch | Bundesnetzagentur


.avif)
%20(1).jpeg)